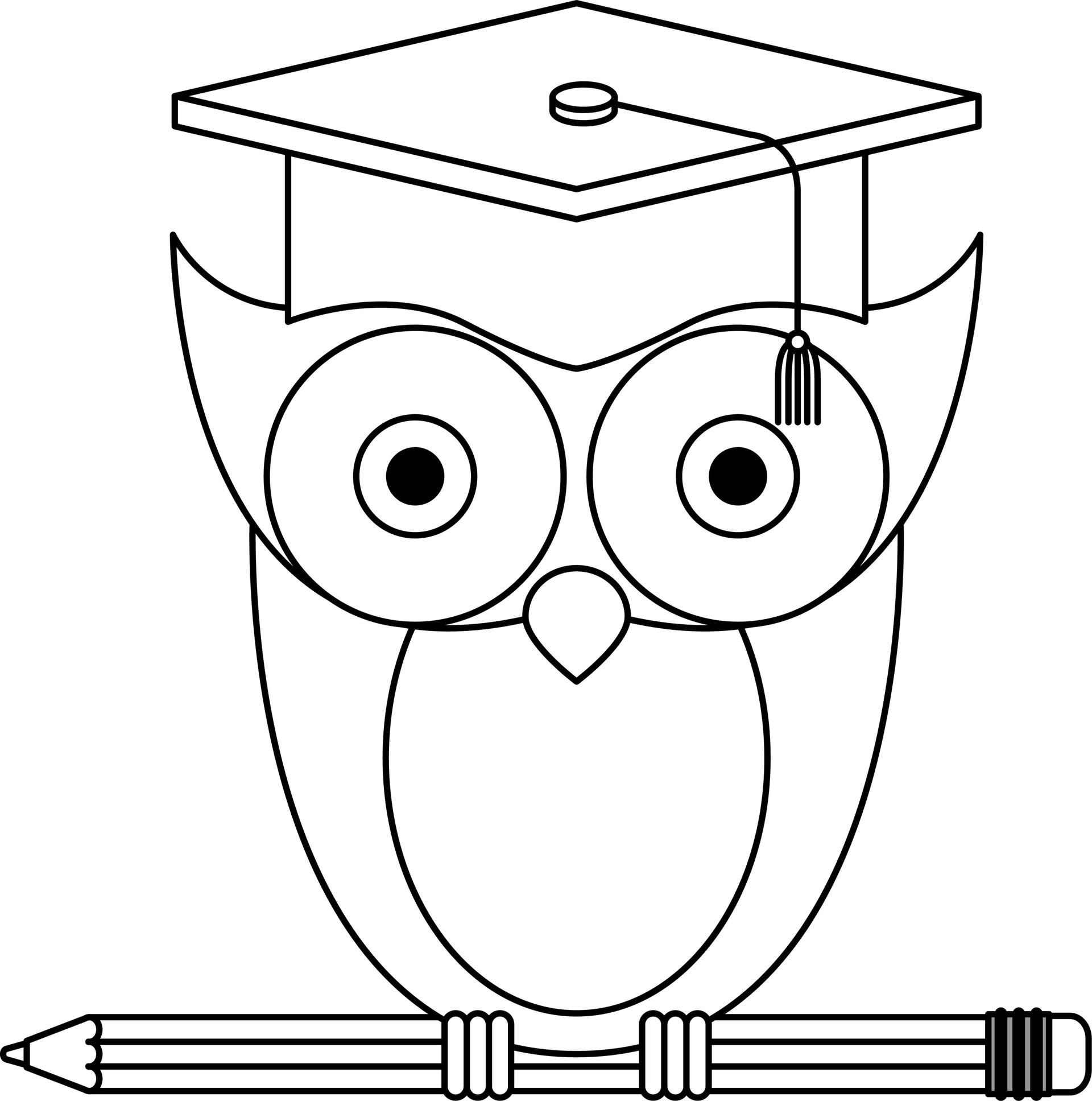Bolivien: Rolle rückwärts?
© Dr. Robert Lessmann • 20. November 2025
Die Amtsübernahme durch Rodrigo Paz Pereira, den 68. Präsidenten Boliviens am, 8. November, stellt für nahezu alle Beobachter eine „Zeitenwende“ nach zwei Jahrzehnten der Regierung des Movimiento al Socialismo (MAS) dar. Seine Christdemokratische Partei (PDC) ist freilich ein Wahlverein ohne Programm und Basis. Wohin die Reise geht, bleibt abzuwarten. Nach einem Wahlkampf, der von persönlichen Anfeindungen und Inhaltsleere geprägt war, sind allenfalls einige Wegweiser zu erkennen. Im Vordergrund steht die Aufgabe, das Land aus einer akuten Wirtschaftskrise zu führen. Die politischen Rahmenbedingungen laden nicht zur Zuversicht ein. Bolivien könnten weiter schwierige Jahre bevorstehen.

Der Wahlsieg war mit 54:45 Prozent in der Stichwahl ebenso überzeugend wie insgesamt überraschend. Rodrigo Paz Pereira ist auf der großen politischen Bühne seines Landes ein Newcomer. Vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 17. August hatte ihn kaum jemand auf der Rechnung. Seine politische Karriere begann er im Jahr 2002 als Abgeordneter des Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
(Bewegung der Revolutionären Linken - MIR), das sein Vater, Jaime Paz Zamora (später 60. Präsident von 1989 bis 1993), im Jahr 1971 während der Zeit der Militärdiktaturen im chilenischen Exil mitbegründete. Zwischen 2015 und 2020 war Paz Pereira Bürgermeister seiner Heimatstadt Tarija und ab 2020 Senator von Carlos D. Mesas Comunidad Ciudadana. Nun gewann er auf dem Ticket der bisher bedeutungslosen Christdemokratischen Partei (PDC) zunächst mit 32,06 Prozent der Stimmen vor dem zweiten Jorge „Tuto“ Quiroga (Libre) mit 26,7 Prozent. Die Linke, die mit dem Movimiento al Socialismo
(MAS) in den letzten zwei Jahrzehnten seit 2005 stets absolute Mehrheiten erzielt hatte, ist zersplittert und in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. (Wir berichteten in diesem Blog: "Bolivien: Totalschaden für die Linke" und frühere Beiträge.)
Das heißt auch: Im Parlament wird sich die neue Regierung Mehrheiten suchen müssen. Der ursprünglich favorisierte Unternehmer Samuel Doria Medina (Unidad), der unter Vater Jaime Paz einmal Minister war, landete auf dem dritten Platz und hat bereits seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit erklärt. Ebenso wie der in Umfragen vor der Stichwahl ebenfalls favorisierte klare Verlierer „Tuto“ Quiroga (54:45 Prozent). Alle drei „Parteien“ sind rechts der Mitte zu verorten. Zusammen kämen sie sogar auf eine Zweidrittelmehrheit. In der Vergangenheit hatte bei Bedarf die US-Botschaft solche Allianzen geschmiedet.
„Kapitalismus für alle…“
…lautet Paz‘ Versprechen. Bolivien ist ein Land ohne Kapitalisten (sprich: unternehmerische Tradition). Bis 1952 beherrschten drei Zinnbarone die wirtschaftlichen und politischen Geschicke. Nach der Revolution von 1952/53 folgte eine Periode des Staatskapitalismus, die politisch unter anderem deshalb scheiterte, weil sich mit Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce und Juan Lechín mehrere Caudillos um die Kontrolle des regierenden Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) stritten. Eine Parallele zur Aktualität: Um die MAS und ihr Erbe stritten sich vor ihrem Niedergang Luis Arce, Evo Morales, Andrónico Rodríguez und Eduardo del Castillo. Seinerzeit folgten von 1964 bis 1982 lange Jahre teilweise blutiger Militärdiktaturen. Der Staatskapitalismus dauerte an.
Ihm folgte ab 1982 eine gewählte Linksregierung, die 1986 an einer Hyperinflation zerbrach. Der Führer der Revolution von 1952, Víctor Paz Estenssoro, gewann die Wahlen und leitete eine neoliberale Strukturanpassung nach Vorgaben des IWF ein, die bei hohen sozialen Kosten makroökonomische Stabilisierung brachte. Für die maroden Staatsbetriebe wollte sich aber fast ein Jahrzehnt lang kein Käufer finden, bis sie in der ersten Hälfte der 1990er Jahre zu Sonderkonditionen überwiegend an ausländische Investoren verhökert wurden. Bolivien wurde zum Aid Regime, ausländische „Entwicklungshilfe“ zum Akkumulationsersatz. Das interne Steueraufkommen reichte oft nicht einmal aus, um die Staatsbediensteten zu bezahlen. Ein Jahrzehnt später war das Modell gescheitert und die MAS übernahm im Januar 2006 nach einem Erdrutschsieg das Ruder.
Das Wirtschaftsmodell soll heute also weniger staatszentriert sein und mehr auf Marktwirtschaft und Privatinvestitionen setzen. Vor allem aber wird es auf Auslandsfinanzierung angewiesen sein. In der Ministerriege fallen erfahrene Technokraten auf. Einige haben für die Vereinten Nationen gearbeitet, andere waren vor 2006 schon einmal Minister. Die Umstellung dürfte weniger rabiat erfolgen als unter der selbsternannten Interimsregierung, die nach der Machtergreifung der Rechten im November 2019 ein Jahr lang nach Kräften versuchte, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, oder auch unter Quiroga, der bereits unter dem Exdiktator Hugo Banzer (1997-2001) einmal als Vizepräsident und nach dessen Krebstod ein Jahr lang bis 2002 auch als Präsident einen strikt neoliberalen Kurs fuhr.
Leicht wird es nicht werden. Die Kassen sind leer und das Land leidet seit Monaten unter Treibstoff- sowie Devisenknappheit. Gleich am Tag nach der Amtseinführung konnte der neue Präsident einen Lkw-Konvoi mit hunderten von Zisternen voll Treibstoff begrüßen. Erinnerungen an Chile 1973 drängen sich auf. Eine erste Auslandsreise hatte den designierten Präsidenten schon vorher nach Washington geführt, von wo er Kreditzusagen (die Rede ist von sechs Milliarden US-Dollar) mitbrachte sowie eine Vereinbarung, umgehend wieder diplomatische Beziehungen auf Botschafterebene aufzunehmen. Zur Erinnerung: Präsident Morales hatte diese nach dem Zivilputsch vom September 2008 abgebrochen; zur Jahrtausendwende entsprachen ausländische „Entwicklungshilfen“ jeweils etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zur Amtseinführung waren Vertreter Nicaraguas, Venezuelas, Kubas und des Iran ausdrücklich nicht eingeladen. Ein deutliches Zeichen für den Kurswechsel in der Außenpolitik.
Ohne Basis, Programm und Struktur
Die PDC ist eine Partei ohne Programm und ohne Basis. Ein Blick auf die politische Landkarte zeigt aber ein Spiegelbild der bisherigen Polarisierung. Paz gewann die Stichwahl in sechs von neun Departements (in La Paz, Cochabamba, Potosí und Oruro mit mehr als 60 Prozent). Quiroga gewann in den Tieflanddepartements Santa Cruz und Beni; nahezu gleichauf lagen beide in Tarija. Darin zeigt sich noch einmal die Tragik des politischen Versagens der MAS. Deren frühere Wählerinnen und Wähler im Hochland entschieden sich nun doch eher für die moderate Rechte, zumal der Vizepräsidentschaftskandidat von Libre, Juan Pablo Velasco, wiederholt durch rassistische Äußerungen aufgefallen war.
Damit ist nicht gesagt, dass die neue Regierung auch auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Wählerklientel eingehen wird. Bei der konnte nicht zuletzt der nunmehrige Vizepräsident Edmand Lara punkten, ein Polizist, der aus dem Dienst entlassen worden war, nachdem er Polizeikorruption angeprangert hatte. Der erklärte Bewunderer des salvadorianschen Präsidenten Nayib Bukele erwarb sich so einen Ruf als unbestechlicher Korruptionsbekämpfer und besticht selbst durch fleißiges Posten populistischer Äußerungen auf TikTok. Seinen Amtseid legte er in Polizeiuniform ab. Es gibt Beobachter die meinen, mit ihm als Spitzenkandidat hätte die PDC im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen können. Dementsprechend fällt Lara durch großes Selbstbewusstsein und Ambitionen auf, beklagt mangelnde Kommunikation von Paz mit ihm und betont bei jeder Gelegenheit, er würde in der Regierung nicht fünftes Rad am Wagen sein. Möglich, dass Lara sich als stärkste Oppositionskraft in der eigenen Regierung herausstellt. Übrigens: Laras Frau wurde – wie Quirogas Schwester – schon im ersten Wahlgang auf einem sicheren Listenplatz Abgeordnete.
Kapitalismus für alle, das Versprechen dürfte sich neben ausländischen Investoren vielleicht noch für eine neue Mestizo-Bourgeoisie erfüllen, die gestärkt aus dem proceso de cambio
der MAS-Jahre hervorgegangen ist. Sie sorgt sich um ihr kürzlich erworbenes Vermögen, scheut staatliche Kontrolle und Interventionismus, möchte aber auch nicht gänzlich auf Regulierung verzichten. Die Umverteilungspolitik der MAS beruhte auf dem Export von Erdgas und Erdöl, auf Extraktivismus, und war von der Preisentwicklung auf den Weltmärkten abhängig. Die Erschließung neuer Quellen hatte man vernachlässigt, auf Diversifizierung lange verzichtet. Obwohl Bolivien wahrscheinlich auf den weltweit größten Lithiumvorkommen sitzt und man von Anfang an gute Konzepte hatte – nicht nur den Rohstoff wollte man exportieren, sondern zumindest Batterien – ist auch dabei nichts Zählbares weitergegangen. Nachdem sich die Europäer 2019 selbst aus der Poleposition geschossen hatten, auch nicht mit zuletzt chinesischen und russischen Partnern.
Die Herausforderungen sind groß. Der informelle Sektor ist weiter angewachsen. 85 Prozent der Menschen sollen ganz oder teilweise auf ihn angewiesen sein. Das Budgetdefizit lag 2024 bei 10,62 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Jährlich wiederkehrende Großfeuer und die Vergiftung von Flüssen durch Goldsucher stellen große ökologische Herausforderungen dar. Ob es gelingt, den Kokainhandel weiterhin einzudämmen, ist eine Frage. Hier wird derzeit heiß über eine mögliche Rückkehr der Drug Enforcement Administration
(DEA) diskutiert, die aus Gründen der nationalen Souveränität von Morales zusammen mit der US-Botschaft des Landes verwiesen worden war.
Schließlich stehen Fragen der gesellschaftlichen und staatlichen Verfasstheit an: Im zweiten Kabinett Morales gab es einmal Geschlechterparität. Darüber hinaus ist so wenig passiert wie beim Umweltschutz – den "Rechten der Pachamama“. Feminizide sind an der Tagesordnung. Die öffentliche Sicherheit ist generell ein wachsendes Problem, das Gefängniswesen katastrophal. Fälle indigener Autonomien lassen sich, anderthalb Jahrzehnte nachdem sie vielbeachtetes Novum in der neuen Verfassung waren, an den Fingern einer Hand abzählen. Immerhin: Im Gegensatz zu politischen Gegnern wie Quiroga steht Rodrigo Paz zu Bolivien als plurinationalem Staat, wie er in der Verfassung von 2009 verankert ist, und nicht für eine Rückkehr zur Republik, die stets excluyente
und diskriminierend war.
Schon in der Woche nach der Amtseinführung wurde ein Dialog mit der Justiz gestartet. Deren erbärmlicher Zustand war mit unterschiedlichen Urteilen zum passiven Wahlrecht von Morales, je nach Maßgabe der jeweiligen Machtverhältnisse, unübersehbar geworden und erreichte bereits in der Woche nach den Wahlen mit der Einstellung von Verfahren sowie der Freilassung von Beschuldigten im Zusammenhang mit den Ereignissen vom November 2019 seinen Höhepunkt. Zuletzt wurde auch die „Interimspräsidentin“ Jeanine Añez freigelassen, die den Sicherheitskräften per Dekret Straffreiheit zugesichert hatte. Im nunmehr eingestellten Verfahren ging es unter anderem um die Massaker von Sacaba (15.11.) und Senkata (19.11.) mit zusammen mehr als 20 Todesopfern.
Just während dieser Beitrag online ging, hat Präsident Paz den frischernannten Justizminister Freddy Vidovic entlassen, der eine Vorstrafe wegen Bestechung und Beihilfe zur Flucht eines Geschäftsmannes verschwiegen hatte. Vidovic war Anwalt Laras gewesen und der einzige von dessen Gefolgsleuten im Kabinett. Nur Stunden später löste Paz gleich das ganze Justizministerium auf. Ob das der richtige Weg ist?
Von der Straffreiheit zur „Unterhaltsamkeit“?
Die Absolution für die formal verantwortliche Frau Añez, die von MASistas als „fotogene Barbiepuppe der Putschisten von 2019“ und „Bauernopfer“ angesehen wird, mag nach fünf Jahren gerecht erscheinen. Gingen doch aktive Täter leer aus und wichtige Drahtzieher haben bei den zurückliegenden Wahlen sogar kandidiert, während sie im Frauengefängnis von Miraflores saß.
Unterdessen wurde der glücklose Amtsvorgänger Luis Arce, der inzwischen wieder Wirtschaftsvorlesungen an der UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) gibt, von den Verwaltern des Parteikürzels MAS (die mit 3,1 Prozent der Stimmen gerade noch Parteistatus behalten durfte) aus der Partei ausgeschlossen. Ein weiteres Bauernopfer? Soll so womöglich der Weg für eine Rückkehr von Morales bereitet werden? Letzterer sitzt weiterhin unter dem Schutz seiner Getreuen in einer tropischen Palisadenfestung in seiner Hochburg, dem Kokaanbaugebiet des Chapare. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor, weil er nicht zu einer gerichtlichen Anhörung erschienen ist. Ihm wird vorgeworfen, mit einer seinerzeit 15-jährigen ein Kind gezeugt zu haben. Weil ihm wiederholt minderjährige Frauen ins argentinische Exil zugeführt worden sein sollen, lautet ein weiterer Vorwurf auf Menschenhandel.
Mit seinem Aufruf, aus Protest gegen die Nichtzulassung zur Kandidatur ungültig zu wählen, landete der Hauptverantwortliche für den Zerfall der MAS im ersten Wahlgang indirekt immerhin bei rund 15 Prozent, mehr als die anderen Konkurrenten auf der Linken zusammen. Während die sich weiterhin in einer Art Schockstarre zu befinden scheinen, mischt Morales mit seinem kommunalen Radio bereits wieder in der politischen Auseinandersetzung mit. Von einem „Delinquenten mit Territorium, Radiostation und Straflosigkeit“, den man stoppen müsse, sprach der Präsidentenvater Jaime Paz Zamora. Morales sprach ihm seinerseits „die Moral“ zu urteilen ab, weil er in betrunkenem Zustand einen Passanten totgefahren und seinerzeit „Ströme von Blut“ durchschwommen habe, als er 1989 mit dem Exdiktator Banzer koalierte, um den Wahlsieger „Goni“ Sánchez de Lozada auszubremsen und selbst Präsident zu werden. (Vor den Wahlen hatte Jaime Paz damals erklärt: „Von Banzer trennen uns Ströme von Blut“. „Goni“ wurde später zweimal Präsident und noch später im Exil von einem US-Gericht wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt.)
Es verbietet sich natürlich, vom Vater auf den Sohn zu schließen. Der erklärte, man habe nicht ein Land im Stillstand übernommen, sondern eine „Kloake der Korruption“ und spricht von „veruntreuten 15 Milliarden Dollar oder mehr“. Was aus den einstmals so starken sozialen Bewegungen wird, ob sie sich erholen? Auch sie sind tief gespalten. Gerade wurde der kürzlich als Chef des mächtigen Gewerkschaftsbundes COB zurückgetretene Juan Carlos Huarachi wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet.
Damit scheinen zumindest einige Wegweiser erkennbar, wie es politisch in Bolivien weitergehen könnte, das bis 2005 fast zwei Jahrhunderte lang als instabilstes Land Lateinamerikas gegolten hatte. Rechtsradikale und Kettensägenpolitiker scheinen dem Land vorerst erspart geblieben zu sein. Doch es könnte „unterhaltsam“ werden – zumindest für unbeteiligte Beobachter.