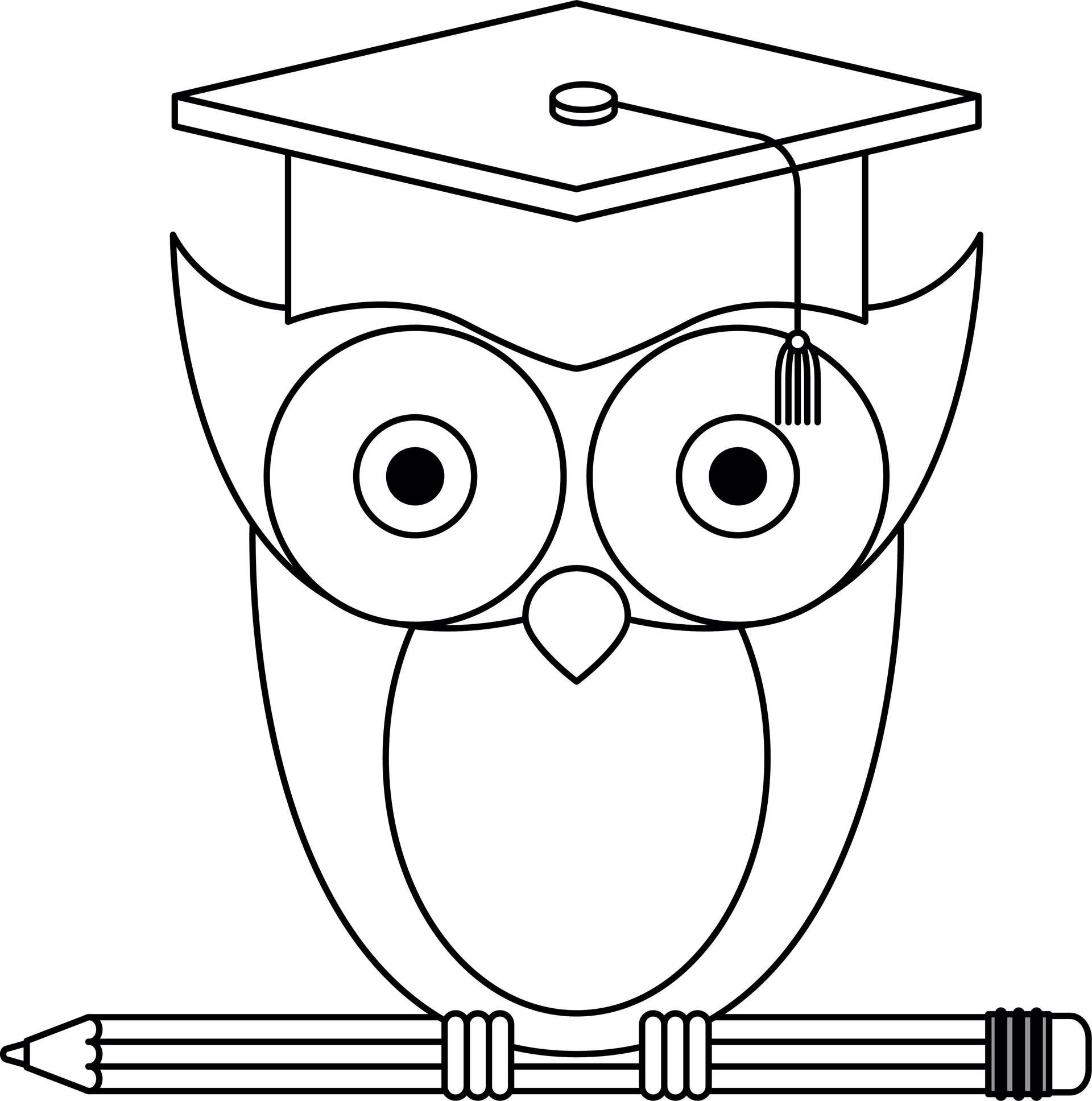Wien im März 2024. Die kolumbianische Botschafterin war in ihrem Schlusswort sehr klar: „Als ich vor einem Jahr erstmals hier sprach, stellte ich mich mit den Worten vor: ‚Ich heiße Laura Gil. Ich komme aus Kolumbien und ich bin müde.‘“ Müde von der Gewalt, den Toten, den leeren Versprechungen. Ein Jahr später müsse sie sagen: „Wir sind heute 60 Länder und wir sind es leid!“
Laura Gil sprach auf einem so genannten side event im Rahmen der 67. UN Commission on Narcotic Drugs.(1) Obwohl eine Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen (UNGASS) zum Thema Drogen im Jahr 2016 eine flexiblere Auslegung der einschlägigen Konventionen versprochen hatte, sei in der Praxis alles so starr und bürokratisch geblieben wie eh und je, sagte Gil, die zuletzt als Vize-Außenministerin ihres Landes für multilaterale Beziehungen zuständig war. UNGASS 2016 war auf Initiative Mexikos, Kolumbiens und Guatemalas einberufen worden: Eine Überarbeitung des bisherigen Ansatzes der internationalen Gemeinschaft gegenüber Drogen könne nicht länger aufgeschoben werden, hieß es bereits in einer gemeinsamen Erklärung vom 1. Oktober 2012. Dabei müssten die Vereinten Nationen eine Führungsrolle übernehmen, um „alle Optionen zu analysieren, einschließlich regulierender – oder Marktmechanismen, um ein neues Paradigma zu etablieren, das den Ressourcenfluss zu Gruppen organisierter Kriminalität verhindert.“ Herausgekommen ist das Versprechen größerer Flexibilität. In der Tat wurden seither Entkriminalisierungs- und Regulierungsmodelle bei Cannabis toleriert.
Neustart als Rohrkrepierer
Zu einer energischen Schwerpunktsetzung beim Kampf gegen die organisierte (Gewalt-) Kriminalität und die Geldwäsche – wie es die Lateinamerikaner gefordert hatten – kam es jedoch nicht. Im Jahr 2011 hatte das Büro für Drogen und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen (UNODC) eine bahnbrechende Studie über Geldwäsche vorgelegt. Demnach lag deren jährliches Volumen damals zwischen 1,2 und 1,6 Billionen US Dollar. Der größte Anteil entfalle mit 350 Mrd. auf den Drogenhandel und dabei wiederum auf den mit Kokain, der besser organisiert und zentralisierter sei als der mit anderen illegalen Substanzen. Zum Vergleich: Der aktuelle Budgetentwurf der deutschen Bundesregierung liegt bei 470 Mrd. €. Der illegale Drogenhandel sei gewissermaßen das Rückgrat der internationalen organisierten Kriminalität, hieß es damals in UNODC-Papieren. Indes: Eine längst überfällige Aktualisierung dieser Studie ist nicht in Sicht. Unter dem damaligen Exekutivdirektor des UNODC, Antonio Maria Costa (2002-2010 - ein Banker übrigens), habe man sich dieses heiklen Themas angenommen. Seither fehle der politische Wille dazu, ist aus dem UNODC zu vernehmen.
Dabei wäre es sechs Jahrzehnte nach der Verabschiedung der maßgeblichen UNO Drogenkonvention und einem halben Jahrhundert von Washingtons federführendem „War on Drugs“ höchste Zeit, neue und innovative Wege einzuschlagen. Die Zahl der Drogenkonsumenten befindet sich auf Rekordniveau und wächst schnell weiter. Schneller noch wachsen die Opferzahlen, vor allem durch neue, im Labor hergestellte psychoaktive Substanzen. Überdosen mit dem künstlichen Opioid Fentanyl sind heute die häufigste Todesursache für Männer zwischen 18 und 45 Jahren in Nordamerika. Die Produktion der klassischen, pflanzengestützten Drogen Kokain (Grundstoff sind die Blätter des Kokabusches aus Bolivien, Kolumbien und Peru) und Heroin (Schlafmohn/Opium aus Afghanistan, Myanmar und Mexiko) befindet sich jeweils auf Rekordniveau. Sogenannte Neue Psychoaktive Substanzen drängen mit einer Schnelligkeit und Vielfalt auf den Markt, die schon ihre Erfassung und damit das Kontrollsystem der Drogenkonventionen über Listen kontrollierter Substanzen überfordert. Zusammen mit einer wachsenden Rolle des Darknet beim Handel schränkt das die Zugriffsmöglichkeiten der Exekutive drastisch ein. Therapie und Prävention scheinen die wesentlich effektiveren Instrumente zu sein. Doch in der Praxis dominiert allenthalben noch immer der repressive Ansatz über das Strafrecht.
Diese konventionelle Politik ist in Bausch und Bogen gescheitert. Es gab allenfalls regionale Schwerpunktverlagerungen. Inwieweit ein Anbauverbot der Taliban für Schlafmohn in Afghanistan vom April 2022 nachhaltig sein wird, bleibt vor dem Hintergrund voller Lagerbestände abzuwarten. Ein ebensolches Verbot vom Jahr 2000/2001 war es jedenfalls nicht. Immerhin ist aktuell ein Rückgang der dortigen Opiumproduktion um 95 Prozent zu verzeichnen. Zwanzig Jahre westlicher Sicherheitskooperation waren dagegen von einem stetigen Anwachsen des Anbaus in Afghanistan begleitet. Schon nimmt der Anbau beim vormals wichtigsten Schlafmohnproduzenten, Myanmar, rapide zu.
Das Epizentrum des Kokaanbaus verlagerte sich bereits in den 1990er Jahren aus den traditionellen Anbauländern Bolivien und Peru nach Kolumbien (ohne dort zu verschwinden oder auch nur nachhaltig vermindert zu sein) und zwischenzeitlich auch wieder zurück. Man spricht vom Ballon Effekt; Druck an einer Stelle führt zur Ausdehnung anderenorts. Heute befinden sich 204.300 Hektar Anbaufläche (von insgesamt 296.000) in Kolumbien (2). Die Schaltzentralen des Kokaingeschäfts verlagerten sich von Kolumbien nach Mexiko, doch produziert wird nach wie vor in Kolumbien, wo rund zwei Drittel der Kokainlabors entdeckt und zerstört werden. Mehr als von einer Verlagerung muss man also von einer Ausbreitung des illegalen Drogengeschäfts und der mit ihm verbundenen Probleme sprechen.
Ecuador, Kolumbien und der War on Drugs
Jüngstes Beispiel dafür ist Ecuador, das in einer Welle von Gewalt versinkt, wie die deutsche Tagesschau am 11. Januar 2024 titelte. Ecuador, dabei dachte man an Galapagos, den 6.263 Meter hohen Chimborazo, Charles Darwin und Alexander von Humboldt, ein stark von seiner indigenen Bevölkerung geprägtes Land und jenes mit der wahrscheinlich größten Artenvielfalt. Doch heute ist Ecuador ein wichtiges Transitland für Kokain geworden. Aus dem friedlichen und aufstrebenden Ecuador wurde eines der gefährlichsten Länder Lateinamerikas.
Wie kam es dazu? Ecuador hat mit Guayaquil einen großen Seehafen und eine fast 600 Kilometer lange Grenze zum Nachbarland Kolumbien, wo seit vielen Jahren etwa zwei Drittel des auf den illegalen Weltmärkten erhältlichen Kokains erzeugt werden. Ein halbes Jahrhundert War on Drugs , Milliarden von Dollars, US- Militärbasen und Sprühflugzeuge mit Glyphosat gegen Kokafelder haben daran nichts geändert. Älteren Leserinnen und Lesern sind die Namen Pablo Escobar, Carlos Lehder, die Ochoa-Familie und die Rodríguez-Orejuela in Erinnerung, das Cali- und das Medellín-Kartell (der völlig falsche Ausdruck übrigens, aber von der Journaille so eingebürgert) in Erinnerung, die Ende der 1980er, Anfang der 90er Jahre gegen ein Auslieferungsabkommen mit den USA anbombten. Allein drei Präsidentschaftskandidaten starben, dutzende Richter, Staatsanwälte, Journalisten wurden damals ermordet. Nach der Zerschlagung der mächtigen „Kartelle“ übernahmen Dutzende kleinere Organisationen das unvermindert boomende Geschäft, die nicht mehr über die Kontakte in die Anbauregionen in Bolivien und Kolumbien verfügten. Ungeachtet einer einsetzenden Besprühungskampagne mit Pflanzengift aus der Luft wurde Kolumbien in der zweiten Hälfte der 90er selbst zum wichtigsten Grundstoffproduzenten. Wirtschaftswissenschaftler nennen das Importsubstitution. Der Kokaanbau in Kolumbien verdreifachte sich. Und er breitete sich aus: Waren es zu Beginn der Besprühungen sechs Provinzen, so wurde zur Jahrtausendwende Koka in 23 der 33 kolumbianischen Departments angebaut.
Kokaanbau historisch in Hektar
1986 1995 2000
Bolivien 25.800 48.600 14.600
Kolumbien 24.400 50.900 163.300
Peru 150.400 115.300 43.400
Total 200.440 214.800 221.300
Quelle: UNODCCP Global Illicit Drug Trends bzw. UNODC World Drug Reports
Washington hatte Mitte der 90er den Präsidenten Ernesto Samper mit Korruptionsvorwürfen unter Druck gesetzt und zur Einwilligung in die Besprühungskampagne genötigt. Mit einer Operation Airbridge hatte man zudem versucht, den Import des Zwischenprodukts, der Pasta B ásica de Cocaína , aus Bolivien und Peru einzudämmen. Nicht identifizierte Kleinflugzeuge wurden zur Landung gezwungen oder abgeschossen, bis der Kongress dieses Vorgehen stoppte. Wegen eines Kommunikationsfehlers zwischen dem amerikanischen Aufklärer und dem peruanischen Jäger hatte man versehentlich die Cessna einer US-Missionarsfamilie abgeschossen.
Zunehmend bemächtigten sich nun auch bereits seit 1964 in Kolumbien operierende Guerrillagruppen des illegalen Geschäfts, und stärker noch die rechtsextremen Paramilitärs, die gegen die Guerrilla kämpften. Teilweise hatten diese Gruppen zigtausende Kämpfer unter Waffen, die alle verköstigt, eingekleidet und bewaffnet werden mussten. Hatte die Guerrilla anfangs nur die Kokabauern besteuert und Gebühren für die klandestinen Landepisten der Drogenhändler in den Anbaugebieten erhoben, so wurde das illegale Geschäft zunehmend zum Selbstzweck und verschiedene ihrer frentes stiegen immer tiefer ein. Ab der Jahrtausendwende hielt Washington mit dem Plan Colombia dagegen. Milliarden wurden ausgegeben, sieben Militärbasen in Kolumbien errichtet, Spezialkräfte ausgebildet und die Besprühung mit Glyphosat noch einmal ausgeweitet. Der W ar on D rugs verschmolz mit dem W ar on T error. Nur Weltpolizist Uncle Sam verfügt über eine Abteilung für internationale Drogen- und Gesetzesvollzugsangelegenheiten (INL(3)) im Außenministerium. Ende des vorletzten Jahrzehnts (FY 2010) gingen mehr als 50 Prozent des INL-Budgets in Höhe von insgesamt 878,9 Mio. USD nach Afghanistan und Kolumbien – zwei Schlüsselländer im Krieg gegen den Terror. Zum Vergleich: Das Gesamtbudget des UNODC war nicht einmal halb so hoch.
Nachhaltigkeitsdesaster und Bürgerkrieg
Besprüht wurde nun vor allem in den Guerrilla-Hochburgen im Süden des Landes. Im Laufe der Jahre will man laut Statistik deutlich mehr als das Zehnfache dessen an Feldern vernichtet haben, was jemals als maximale Anbaufläche vorhanden war. Ein Nachhaltigkeitsdesaster. Die Bauern zogen weiter, legten neue Kokafelder an – teilweise schon prophylaktisch. Die Politik der Kokavernichtung ohne Nachhaltigkeit dürfte damit enorme Flächen tropischen Regenwaldes gekostet haben.(4) Doch nicht nur das: Durch die zur Weiterverarbeitung notwendigen Chemikalien wurden immer neue Böden und Gewässer vergiftet. Und Kolumbien war lange noch vor Syrien das Land mit der höchsten Zahl von Binnenflüchtlingen (8 von insgesamt 50 Millionen Einwohnern), wofür hauptsächlich der Guerrillakrieg, aber eben auch Bauernvertreibung durch Kokaeradikation verantwortlich war.
Die Umsetzung des Plan Colombia hieß in Kolumbien unter Präsident Álvaro Uríbe (2002-2010) S eguridad D emocrática und verfolgte das Ziel, illegale bewaffnete Gruppen von ihrer Finanzierung abzuschneiden. Gesprüht wurde nun insbesondere in den Hochburgen der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) im Süden des Landes in den Departments Caquetá und Putumayo. Landesweite Kokareduzierungen um 80.000 Hektar zwischen 2000 und 2004 wurden praktisch ausschließlich dort erzielt.
Im Jahr 2015 wurden die Besprühungen eingestellt, im Jahr 2016 ein Friedensabkommen mit den FARC unterzeichnet. Der Krieg mit der ältesten (seit 1964) und größten Guerrilla war zu Ende. Präsident Juan Manuel Santos erhielt dafür den Friedensnobelpreis. Mehr als 13.000 Kämpfer wurden demobilisiert, Hunderte davon später ermordet. Nachfolger Iván Duque hielt nichts von dem Abkommen und das ehrgeizige Programm zur Schaffung von Alternativen für die Bauern wurde praktisch nicht vollzogen. Duque setzte die Zwangseradikation von Kokafeldern fort und wollte sogar zu einer Besprühung der Felder aus der Luft zurückkehren. Es ist nicht gelungen, das Machtvakuum, das durch den Abzug der Guerrilla entstand, durch staatliche Institutionen zu füllen. Stattdessen geben dort nun FARC-Dissidenten (5.500 Kämpfer), Kämpfer des Ejercito de la Lib e ración Nacional (ELN 2.200) und Angehörige krimineller Banden (8.350 nach offiziellen Zahlen) den Ton an. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2018 gab es in Kolumbien 169.000 Hektar Koka und Duque strebte bis 2023 eine Halbierung an. In einem Working-Paper von 2020/21 für das deutsch-kolumbianische Friedensinstitut Capaz ( www.instituto-capaz.org ) schrieb der Autor dieser Zeilen damals: „Nichts deutet darauf hin, dass die Zielvorgaben heute realistischer sind als vor 10 oder 20 Jahren. Es ist vielmehr zu erwarten, dass die neuerliche Eradikationsoffensive auch diesmal nicht nachhaltig sein wird und es besteht die Gefahr, dass damit die Unsicherheit der Lebensumstände in den betroffenen Gebieten vergrößert wird.“
Heute kämpft die Regierung des Präsidenten Gustavo Petro unter dem Slogan Paz Total gegen verbrannte Erde an. Die Bauern sind einmal mehr vom Staat enttäuscht und desillusioniert. Statt der angestrebten Halbierung ist die Kokaanbaufläche um gut ein Drittel weiter angewachsen und liegt heute (2022) bei 230.028 Hektar, fast die Hälfte davon in den südlichen Departments Putumayo und Nariño im Grenzgebiet zu Ecuador (5). Und damit nicht genug. Durch bessere Sorten und Anbaumethoden soll die Ernte pro Hektar nach Berechnungen des UNODC um durchschnittlich 24 Prozent angestiegen sein und durch Optimierung der Weiterverarbeitung auch der Kokainertrag. Solche neuen Hochproduktivitätszonen befinden sich unter Kontrolle sogenannter narcoparamil i tares, FARC-Dissidenten bzw . der ELN . Alle zusammen werden sie Grupos Armados Ilegales (GAI) genannt. 35 Prozent der Kokaanbauflächen Kolumbiens befinden sich in Zonen, in denen eine oder mehrere GAI präsent sind. Diese arbeiten fallweise zusammen oder bekriegen sich. Aber alle sind um eine strikte Kontrolle des Produktionsprozesses bemüht. Im Department Putumayo lassen sich sechs Gruppen identifizieren, die nahezu umfassende Kontrolle ausüben. Die größten sind ehemalige frentes der FARC, das Comando Frontera und die Frente Carolina Ramírez und sie bekämpfen sich gegenseitig. Gemeinsam ist ihnen allen der Vektor des Kokainabsatzes: der Rio Putumayo. Interessanterweise befindet sich auch auf der südlichen, der peruanischen Seite des Grenzflusses im Departement Loreto ein Koka-Kokain-Nukleus. Auf ihm oder an ihm entlang gelangt die heiße Ware nach Ecuador.
Ecuador: Neoliberalismus und Drogentransit
Immer wieder tauchten in den letzten Jahren in Supermärkten Kokainpäckchen in Bananen- oder Schnittblumenlieferungen aus Ecuador auf, die von den Adressaten übersehen worden waren. Ecuador ist selbst kein Anbauland in nennenswertem Umfang, doch wurde es für den Drogenhandel nicht nur wegen des Pazifikhafens Guayaquil interessant. Kokainbeschlagnahmungen sind dort von 88 Tonnen (2019) auf 201 Tonnen (2022) kontinuierlich angestiegen. Neben dem Seehafen und der langen Landesgrenze zu den wichtigsten Kokain-Produktionszentren verfügt Ecuador noch über weitere, politisch-hausgemachte „Standortvorteile“. Das notorisch exportabhängige Land – vor allem Erdöl mit seinen schwankenden Weltmarktpreisen – befindet sich seit langem in einer wirtschaftlichen Dauerkrise, unterbrochen nur durch einen Boom im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Zur Jahrtausendwende wurde daher die Wirtschaft „dollarisiert“, was Außenhandelsgeschäfte ebenso erleichtert wie die Geldwäsche. Sie soll bei etwa 3,5 Mrd. USD jährlich liegen, was etwa 3 Prozent des BIP entspricht, Geld, das zu 75 Prozent im Land selbst in legale Wirtschaftskreisläufe eingespeist werde. Kolumbianische Wirtschaftswissenschaftler bezeichneten solcherlei Verhältnisse für ihr Land schon von mehr dreißig Jahren als „Verschmutzung der Wirtschaft“ ( la economía se ensucia ) und sprachen von einer „bewilligten Illegalität“ ( ilegalidad consentida ) (6), die der Gesetzgeber billigend in Kauf nehme.
Ecuador war mit seiner neuen Verfassung von 2008 und einer zunächst stärkeren Akzentuierung der Sozial-, Indigena- und Umweltpolitik unter Präsident Rafael Correa einer der Hoffnungsträger der progressistischen Welle in Lateinamerika. Doch eine Abkehr vom Extraktivismus, eine Überwindung der Abhängigkeit vom Erdöl gelang nicht und Correa ging 2017 unter Korruptionsvorwürfen ins französische Exil. Sein Nachfolger, Lenin Moreno, fiel nurmehr durch den scharfen Gegensatz zwischen progressiver Rhetorik und neoliberaler Praxis auf. Proteste ließ er im Jahr 2019 blutig niederschlagen. Das Verhältnis zwischen dem indigenen und dem „progressistischen“ Lage ist so zerrüttet, dass man 2021 den Wahlsieg quasi verschenkte. Während der „Correist“ Andrés Arauz den ersten Wahlgang mit 14 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen hatte und Yaku Pérez das historisch beste Ergebnis für das indigene Lager erzielte, gewann der neoliberale Kandidat Guillermo Lasso die Stichwahl, der im ersten Wahlgang nur 19,5 Prozent der Stimmen bekommen hatte. Statt ein Bündnis einzugehen, bekämpften sich die progressiven Kräfte. Während der 900 Tage seiner Amtszeit soll das Vermögen von Guillermo Lasso um 21 Mio. USD angewachsen sein. Speziell seit der Pandemie wurde unter Moreno und Lasso eine extreme Sparpolitik betrieben, um Auslandsschulden begleichen zu können – nicht zuletzt auch im Sicherheitsbereich. Gerade Lasso war in der Sicherheitspolitik gleichzeitig aber ein Verfechter der „harten Hand“. Das in ganz Lateinamerika notorisch prekäre und hier nun noch einmal besonders vernachlässigte Gefängnissystem wurde mit Kleinkriminellen überfüllt. Vor dem Hintergrund allgegenwärtiger Korruption entwickelten sich die Haftanstalten geradezu zu Hauptquartieren krimineller Banden.
Deren wichtigste, die „Choneros“ arbeiten mit der mexikanischen Sinaloa-Gruppe zusammen, „Los Lobos“ mit der ebenfalls mexikanischen „Jalisco Nueva Generación“. Beide Gruppen bekämpfen sich. Ein Fanal war die Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio, dessen Hauptthemen der Kampf gegen die Korruption und den illegalen Drogenhandel waren, auf einer Kundgebung in Quito im August 2023. Eine Komplizenschaft aus den Reihen der Sicherheitskräfte wird vermutet. Die Hauptverdächtigen wurden später in zwei verschiedenen Gefängnissen ihrerseits ermordet. Ein zweites Fanal war der Ausbruch des Anführers der „Choneros“, Adolfo „Fito“ Macias, Anfang Januar 2024, nachdem er in ein anderes Gefängnis verlegt werden sollte, sowie die bewaffnete Besetzung eines Fernsehstudios während einer Livesendung. Inzwischen hatte der heute 36-jährige, in Miami geborene und steinreiche Unternehmer Daniel Noboa die Wahlen gewonnen. Nach nur wenigen Wochen im Amt, sprach er am 9. Januar von einem „internen bewaffneten Konflikt“ und rief einen 60-tägigen Notstand aus. In kurzer Zeit wurden mehr als 9.000 Menschen verhaftet. Es wird sogar über eine Wiedereröffnung der US-Luftwaffenbasis Manta diskutiert, die im Kontext des Plan Colombia 1999 als sogenannte Forward Operation Location zur Luftraumüberwachung (AWACS) eröffnet worden war. Insgesamt 500 Mann US-Personal genossen damals quasi diplomatische Immunität und Bewegungsfreiheit in ganz Ecuador. Sie war 2008/2009 unter Rafael Correa geschlossen worden und eine Wiedereröffnung würde heute gegen die neue Verfassung verstoßen.
Der Wirtschaftswissenschaftler Alberto Acosta, der unter anderem in Köln studiert hat, war in den Jahren 2007 und 2008 Präsident der Verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors und im ersten Halbjahr 2007 Minister für Energie und Bergbau im Kabinett von Rafael Correa. Er hat Zweifel am Erfolg dieser Politik der Militarisierung: Die Nationalpolizei werde zum Erfüllungsgehilfen des Militärs degradiert. Er spricht vom grundlegenden Problem einer Koexistenz zwischen dem Staat und einigen kriminellen Banden, die nach und nach die staatlichen Institutionen übernahmen. Der Grad der Durchdringung des organisierten Verbrechens sei so groß, dass seine Infiltration fast aller staatlichen Instanzen, der Justiz, der Sicherheitskräfte, des Privatsektors und sogar des Sports öffentlich anerkannt werde.
Vor anderthalb Jahrzehnten reagierte das Kokaingeschäft auf stärkere Kontrollen der europäischen Seehäfen mit dem Absatz über Venezuela und Westafrika entlang des 10. Breitengrades, der die kürzeste Verbindung zwischen Lateinamerika und Westafrika darstellt. Fahnder sprachen damals vom Highway Number 10. Einige der ärmsten Länder der Welt waren nun plötzlich mit einem Millionengeschäft konfrontiert. In der Wüste Malis wurde im Jahr 2009 das Wrack einer aufgelassenen Boeing 727 gefunden, mit der 10 Tonnen Kokain transportiert worden waren: die Air Cocaine. Der Weitertransport durch die Sahara zum Mittelmeer erfolgte über dieselben Routen und durch dieselben Organisationen, die auch im Schleppergeschäft aktiv sind, unter anderem Al Qaeda . Ab 2011 erhielten sie üppige Bewaffnung aus Beständen des gestürzten Diktators Muhammar al Gaddhafi. Und während neuerdings Ecuador die Aufmerksamkeit erregt, zeichnet sich bereits eine Wiederbelebung des Highway Number 10 ab. Wie auch immer die Routen sich ändern: Die Fahnder laufen hinterher.
Drogenbekämpfung und Menschenrechte: ein neuer Anlauf
Zurück nach Wien und zur Commission on Narcotic Drugs. Der War on Drugs sei gescheitert, sagt Volker Türk, der UNO Hochkommissar für Menschenrechte: gescheitert Leben zu retten; gescheitert die Würde, Gesundheit und Zukunft von weltweit 296 Millionen Drogennutzern zu schützen; gescheitert, den Politikwechsel herbeizuführen, den wir dringend brauchen, um weitere Rückschläge bei den Menschenrechten abzuwenden. Die gegenwärtige Drogenpolitik mit ihrem strafenden Ansatz und ihren repressiven Politiken, so Türk, hatte verheerende Folgen für die Menschenrechte auf allen Ebenen. „Drogen töten und zerstören Leben und Gemeinschaften. Aber unterdrückerische und rückwärtsgewandte Politiken tun das auch.“ (Übers. aus dem Englischen R.L.)
Seit der Vorbereitung der UNGASS Konferenz von 2016 werden andere UNO-Organisationen (wie UNAIDS oder das Hochkommissariat für Menschenrechte mit Sitz in Genf) sowie NGO’s in die Drogendebatte einbezogen, die bis dato von den in Wien ansässigen UN „Drogenorganisationen“ dominiert, wenn nicht monopolisiert gewesen war. Drogenpolitik wurde in den Kontext der nachhaltigen UN-Entwicklungsziele (oder Agenda 2030) gestellt – zumindest in den Debatten. Im August 2023 legte das Büro des Menschenrechts-Hochkommissars einen Bericht über Herausforderungen für die Menschenrechte bei der Drogenbekämpfung vor. Der kolumbianische Außenminister Murillo erkannte auf dem genannten side event sofort, den Gegensatz zwischen Wien und Genf. Und die frühere Bundespräsidentin der Schweiz, Ruth Dreyfuss, plädierte für eine dringend notwendige „Kommunion“ der Ansätze , wie sie es formulierte. Es ist hohe Zeit, dass daraus Wirklichkeit wird. Nicht nur in den Diskursen, sondern in der Praxis.
(1) Auf der alljährlich in Wien stattfindenden „Commission“ kommen die Delegierten der Mitgliedsländer zusammen, um die internationale Drogenpolitik zu diskutieren und zu gestalten. Das erwähnte side event (Human rights in global drug policy and the case of the current classification of coca leaf in the 1961 single convention: A debate on the implementation and effectiveness of the international drug control regime) fand am 14. März 2024 statt. Am Podium saßen neben Laura Gil, der bolivianische Vizepräsident David Choquehuanca, der kolumbianische Außenminister Luis Gilberto Murillo, die ehemalige Bundespräsidentin der Schweiz, Ruth Dreyfuss (als Mitglied der Global Commission on Drug Policy) sowie der UN Hochkommissar für Menschenrechte, der Österreicher Volker Türk.
(2) Der World Drug Report 2023 des UNODC nennt für Bolivien 30.500 Hektar und für Peru 80.681 Hektar, was zusammengenommen 315.481 Hektar ergibt. Die Zahlen sind von daher inkonsistent bzw. die Addition fehlerhaft.
(3) Das Bureau for International Narcotics Matters and Law Enforcement Affairs (INL) im State Department wurde 1978 gegründet und 1995 zum heutigen Namen umbenannt. Insgesamt ist das Anti-Drogen-Budget der USA noch erheblich höher und in seinen internationalen Aspekten auf State Department (INL und USAID), Justiz- (DEA) und Verteidigungsministerium verteilt.
(4) Eine auch methodologische Auseinandersetzung mit dem Thema stellt fest: „...that coca cultivation area, number of cattle, and municipality area are the top three drivers of deforestation…“ und die Gewichtung dieser Faktoren sei „highly context-specific“. (Ganzenmüller/Sylvester/Castro-Nuñez: „What Peace Means for Deforestation: An Analysis of Local Deforestation Dynamics in Times of Conflict and Peace in Colombia“ in: Frontiers in Environmental Science Vol. 10, Bucharest, 21.2.2022
(5) UNODC: Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022, Bogotá/ Viena, Septiembre 2023.
(6) Arrieta/ Orejuela/ Sarmiento Palacio/ Tokatlián: „Narcotráfico en Colombia“, Bogotá, 1990.
Volker Türks bemerkenswerte Rede auf dem erwähnten side event : www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/03/war-drugs-has-failed-says-high-commissioner
Sein Statement vor dem Plenum:
www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/03/turk-urges-transformative-change-global-drug-policy
Foto: Verurteilte Drogenkurierin, Frauengefängnis Bogotá 1990. Noch immer werden Haftanstalten mit Kleinkriminellen vollgestopft.
© Robert Lessmann
Weitere Beiträge zum Thema weiter unten in diesem Blog, insbesondere:
www.robert-lessmann.com/kolumbien-drogenbekaempfung-und-friedensprozess
www.robert-lessmann.com/drogenpolitik-augen-zu-und-weiter-so
Álvaro García Linera kennt die politische Realität Lateinamerikas aus Theorie und Praxis. Er wurde 1962 in Cochabamba/ Bolivien geboren. Soziologie studierte der gelernte Mathematiker als Autodidakt während einer fünfjährigen Untersuchungshaft, die er ab 1992 als Mitglied des Ejército Guerillero Túpac Katari (EGTC) verbüßte. Für sein politisches Denken war neben Karl Marx und Antonio Gramsci auch der Vordenker des bolivianischen „Indianismus“ Fausto Reinaga von großer Bedeutung. Nachdem er ohne Urteilsspruch entlassen wurde, arbeitete er als Hochschullehrer und wurde einer der gefragtesten Talkshowgäste und politischen Analytiker. Zentral für sein politisches Denken blieb stets die Frage der indigenen Emanzipation. Im Jahr 2005 wurde er an der Seite von Evo Morales zum Vizepräsidenten seines Landes gewählt, ein Amt, das er bis zu beider Sturz im November 2019 innehatte. (Bild von der Amtseinführung im Januar 2006.) Gemeinsam wurden sie ins Exil gezwungen. Nach der Rückkehr der Regierungspartei Movimiento al Socialismo (MAS) an die Macht, kehrte auch er nach Bolivien zurück, hält sich aber im Gegensatz zu Evo Morales aus der Tagespolitik heraus.
García Linera sieht Lateinamerika – und die Welt – in einer Übergangsphase. Sie sei von Unklarheit und Instabilität gekennzeichnet, wo eine „monströse Rechte“ die Bühne betrete, was wiederum in gewisser Weise eine Folge der Defizite progressiver Kräfte sei. Er nennt diese Zeit „tiempo liminar“. Andere Autoren sprechen vom Kampf zwischen progresismo und Regression. Die Linke, so García Linera, müsse kühner sein und einerseits mit historischer Verantwortung Antworten auf die profunden Fragen an der Basis des sozialen Zusammenhalts geben und andererseits die Sirenengesänge der neuen Rechten neutralisieren. Sie müsse bei grundlegenden Reformen zu Fragen der Eigentumsverhältnisse weiterkommen, bei Steuern, bei der sozialen Gerechtigkeit, der Verteilung des Wohlstands und der Wiedergewinnung der Ressourcen zum Wohle der Gesellschaft. Nur so werde man, ausgehend von den grundlegendsten Forderungen der Gesellschaft und realen Fortschritten bei der Demokratisierung, die Ultrarechten in die Schranken weisen.
Politische Schubumkehr
Das Jahrhundert hatte mit einer Dominanz progressiver Regierungen begonnen. Mit dem Wahlsieg von Mauricio Macri in Argentinien habe 2015 gewissermaßen eine Schubumkehr in Lateinamerika eingesetzt. Andere Länder, wie Brasilien und Honduras, folgten. Teilweise wurden diese Rechtsregierungen inzwischen wieder von progressiven ersetzt. García Linera sieht das als Ausdruck einer Umbruchphase des zeitgenössischen Kapitalismus – Gramsci hatte von „Interregnum“ gesprochen –, wo sich Wellen und Gegenwellen ablösen ohne dass sich eine Tendenz durchsetzt. Lateinamerika habe damit eine Entwicklung vorweggenommen, die wir heute auf der ganzen Welt beobachten können. Der Halbkontinent erlebte eine intensive progressive Welle, die von einer konservativen Gegenbewegung gefolgt wurde und dann von einer neuerlichen progressiven. Möglicherweise, so García Linera, werden wir sehen, dass sich eine solche Abfolge kurzfristiger Wechsel noch fünf bis zehn Jahre fortsetzt, bis sich ein neues Modell der Akkumulation und Legitimation durchsetzt, das neue Stabilität für Lateinamerika und die Welt bringt. Insoweit das nicht geschieht, werden wir in einem Wirbel der Zeit des Interregnums feststecken. Man erlebe progressive Wellen, ihre Erschöpfung, konservative Gegenreformen, neue progressive Wellen. Und jede dieser Wellen sei verschieden von der anderen. „Milei ist unterschiedlich zu Macri, obwohl er manches von ihm übernimmt. Alberto Fernández, Gustavo Petro und Manuel López Obrador unterscheiden sich auch von ihren Vorgängern, obwohl sie einen Teil von deren Erbe übernehmen“, stellt García Linera fest: „Und so wird es weiter gehen bis sich eines Tages eine neue Weltordnung definiert, denn diese Instabilität und dieses Leid können nicht endlos sein“, meint er. Im Grunde würden wir einen zyklischen Niedergang des Akkumulationsmodells sehen, wie wir das bereits nach der liberalen Phase des Kapitalismus (1870-1920), der staatskapitalistischen (1940-1980) und der neoliberalen (1980-2010) gesehen haben, argumentiert er in Anlehnung an Nicolai Kondratiews Theorie der Wirtschaftszyklen. Das Chaos sei Ausdruck des historischen Niedergangs und des Kampfes um ein neues und dauerhaftes Modell der Akkumulation, das wieder Wachstum und sozialen Zusammenhalt bringt.
Polarisierung
Die Rechte verwende dabei Praktiken, die man glaubte überwunden zu haben, wie Putsche, politische Verfolgung, Mordversuche. Zu dieser Übergangszeit gehöre, dass die politischen Eliten auseinanderdriften. Wenn die Dinge gut liefen, wie etwa bis zur Jahrtausendwende, fänden sie sich um ein Akkumulations- und Legitimationsmodell zusammen. Die Linke mäßigt sich, „neoliberalisiert“ sich, obwohl es immer eine radikale Linke ohne Publikum geben wird. Die Rechten streiten unter sich. Wenn der Niedergang beginnt, tauche die extreme Rechte auf und werde stärker. Die extreme Rechte fresse die moderate Rechte auf, und die radikale Linke trete aus ihrer Marginalität und politischen Bedeutungslosigkeit. Sie gewinne an Resonanz und Publikum. Sie wachse. „Im Interregnum ist das Auseinanderdriften der politischen Projekte die Regel, weil es bei der Suche nach Lösungen für die Krise der alten Ordnung Dissidenten auf beiden Seiten gibt“, konstatiert er. Die rechte Mitte, die den Halbkontinent und die Welt über 30 oder 40 Jahre regiert hat, finde keine Antworten mehr auf die deutlichen Fehler des globalisierten, neoliberalen Kapitalismus und die Zweifel und Ängste der Menschen. Es tauche eine extreme Rechte auf, die weiter das Kapital verteidigt, die aber glaubt, dass die alten Rezepte nicht mehr genügen und man die Gesetze des Marktes mit Gewalt durchsetzen müsse. Sie will die Menschen domestizieren, wenn nötig mit Gewalt, um zu einem reinen, ursprünglichen freien Markt ohne Zugeständnisse und Doppelbödigkeiten zurückzukehren. Sie konsolidiert sich, indem sie von Autorität, von Schocktherapie des freien Marktes und Reduzierung des Staates spricht. Und wenn es dagegen soziale Widerstände gibt, müsse man dem mit Stärke und Zwang begegnen, und wenn nötig auch mit Staatsstreich und Massakern, um die Widerspenstigen, die sich der Rückkehr zur guten Gewohnheit des freien Unternehmertums und des zivilisierten Lebens widersetzen, zu disziplinieren: mit den Frauen am Herd, den Männern, die befehlen, den Chefs, die entscheiden und den Arbeitern, die schweigend ihre Arbeit tun. Ein weiteres Symptom des liberalen Verfalls tritt zu Tage, wenn sie nicht mehr überzeugen und verführen können, sondern Zwang brauchen, was bedeutet, dass sie bereits dem Untergang geweiht sind. Nichtsdestoweniger bleiben sie gefährlich.
Angesichts dessen könnten die progressiven Kräfte und die Linke nicht nachgiebig sein und versuchen, es allen sozialen Sektoren und Fraktionen recht zu machen. Die Linke tritt in der Übergangszeit aus ihrer Marginalität heraus, indem sie sich als Alternative zum wirtschaftlichen Desaster präsentiert, das vom unternehmerischen Neoliberalismus verursacht wird. Ihre Funktion könne es nicht sein, einen Neoliberalismus „mit menschlichem Antlitz“ einzuführen, einen grünen oder progressiven Neoliberalismus. „Die Menschen gehen nicht auf die Straße oder wählen die Linke, um den Neoliberalismus zu verzieren. Sie mobilisieren sich und wechseln radikal ihre alten politischen Bindungen, weil sie ihn satt haben und ihn loswerden wollen, weil er nur einige wenige Familien und Unternehmen reich gemacht hat. Und wenn die Linke es nicht schafft, sich als Alternative zu präsentieren, ist es unausweichlich, dass die Menschen sich der extremen Rechten mit ihren (illusorischen) Auswegen aus der allgemeinen Misere zuwenden“, fürchtet García Linera. Dazu müsse die Linke, wenn sie die Rechte aus dem Feld schlagen will, Antworten auf die drängenden Fragen geben. Sie muss die Armut der Gesellschaft bekämpfen, die Ungleichheit, die Unsicherheit der Dienstleistungen, Bildung, Gesundheit, Wohnen. Und um die materiellen Bedingungen dafür zu schaffen, muss sie radikal sein in ihren Reformen zu Fragen des Eigentums, der Steuerpolitik, der sozialen Gerechtigkeit, der Verteilung des Wohlstands, der Wiedergewinnung der gemeinsamen Ressourcen zum Wohle der Gesellschaft. Zurückhaltung dabei wird die sozialen Krisen vergrößern. Angesichts des Ausmaßes der Krise wird moderates Vorgehen die Extreme stärken. Wenn es die Rechten tun, stärken sie die Linken und umgekehrt. Worum es geht, sind wirtschaftliche und politische Reformen, die zu sichtbaren und dauerhaften materiellen Verbesserungen der Lebensbedingungen für die gesellschaftliche Mehrheit führen, zu einer größeren Demokratisierung der Entscheidungen, einer größeren Demokratisierung des Reichtums und der Eigentumsverhältnisse. Die Eindämmung der extremen Rechten wird nicht einfach ein Diskurs sein, sondern in einer Reihe von praktischen Maßnahmen zur Verteilung des Reichtums bestehen, die es erlauben, die wichtigsten Ängste und Forderungen der Bevölkerung anzugehen: Armut, Inflation, Unsicherheit, Ungleichheit. Man darf nicht vergessen, dass das Erscheinen der extremen Rechten ja eine pervertierte Antwort auf diese Ängste ist. „Je mehr du den Reichtum verteilst, desto mehr betrifft das die Privilegien der Mächtigen, aber die bleiben bei deren wütender Verteidigung in der Minderheit, während sich die Linke in dem Maße konsolidiert, wie sie sich um die grundlegenden Bedürfnisse des Volkes kümmert“, sagt der Exvizepräsident.
Analyse statt Etikettierung
Was ist nun neu an der neuen Rechten? Soll man sie faschistisch nennen oder was sonst? Bauen sie an einem postdemokratischen Labor, nicht zuletzt in den USA? Ohne Zweifel tendiere die liberale Demokratie – als bloßer Austausch der Eliten durch das Volk – zu autoritären Formen. Wenn sie manchmal Früchte einer sozialen Demokratisierung hervorgebracht habe, so war es durch das Wirken anderer demokratischer Formen von unten, wie Gewerkschaften, landwirtschaftlichen Organisationen, Stadtteilkomitees, unterstreicht der Soziologe. Wenn man aber die liberale Demokratie sich selbst überlasse, als bloße Auswahl der Regierenden, tendiere sie zur Konzentration von Entscheidungen, zu dem, was der Nationalökonom Josef Schumpeter ‚Demokratie als bloße Auswahl der Regierenden, die über die Gesellschaft entscheiden‘ nannte und was eine autoritäre Form der Konzentration von Entscheidungen ist. Und dieses Monopol autoritärer Entscheidungen, fallweise auch ohne die Auswahl aus den Eliten ist es, was die extreme Rechte auszeichnet. Daher gibt es keinen Antagonismus zwischen der liberalen Demokratie und der extremen Rechten. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie durch Wahlen an die Macht kommt. „Was die liberale Demokratie am Rande und lustlos erlaubt, die extreme Rechte aber offen ablehnt, sind andere Formen der Demokratisierung von unten, wie Gewerkschaften, Stadtteilversammlungen, ländliche Organisationen, kollektive Aktionen. In diesem Sinne sind die extremen Rechten antidemokratisch“, sagt García Linera. Sie erlauben nur, dass man aus ihren Reihen jemanden wählt, der regiert, lehnen aber andere Formen der Teilhabe und der Demokratisierung des Reichtums ab, die sie als Beleidigung ansehen, als Absurdität, die man mit der Ordnungsmacht und Zwangsdisziplinierung bekämpfen muss. Ist das Faschismus? „Schwer zu sagen,“ meint García Linera. Es gebe dazu eine akademische Debatte, aber die politischen Auswirkungen sind eher klein. Die Generation über 60 in Lateinamerika erinnere sich vielleicht noch an die faschistischen Militärdiktaturen, aber der jüngeren Generation sage es nicht viel, vom Faschismus zu reden. Er ist nicht gegen diese Debatte, sieht sie aber nicht als sehr nützlich an. Der soziale Erfolg oder die Ablehnung von Forderungen der extremen Rechten hänge schließlich nicht von alten Symbolen ab, sondern von der Antwort auf die sozialen Ängste. Problematisch sei es indessen, sie als faschistisch zu bezeichnen ohne zu bedenken, auf welche kollektiven Forderungen sie antworten oder vor dem Hintergrund welchen Scheiterns sie auftauchen. Bevor man ihnen Etikette umhängt, sei es besser über die sozialen Bedingungen für ihr Auftauchen nachzudenken. Persönlich spricht er lieber von der extremen oder der autoritären Rechten.
Ob man Milei einen Faschisten nennen soll? Zuerst solle man sich fragen, warum er gewonnen hat, wer ihn gewählt hat, als Reaktion auf welche Sorgen. Ihm ein Etikett umzuhängen, erlaubt moralische Ablehnung, aber es hilft nicht, die Realität zu verstehen oder zu verändern. Wenn die Antwort ist, dass Milei sich auf die Ängste einer verarmten Gesellschaft beruft, dann ist klar, dass Armut das Thema ist. Darauf muss der p rogresismo und die Linke eine Antwort geben und die extreme Rechte oder (wenn man so will) den Faschismus stoppen. Man muss die Probleme erkennen, mit denen die extreme Rechte in der Gesellschaft Anklang findet, denn ihr Anwachsen ist auch ein Symptom für das Scheitern der Linken und der Progressiven. Sie tauchen nicht aus dem Nichts auf, nachdem die Progressiven nicht sahen, nicht bereit waren, konnten oder wollten, die Frage der Klasse, der prekären Jugend, die Bedeutung der Armut, der Wirtschaft zu verstehen und über jene des Rechts auf Identität zu stellen. Man müsse verstehen, dass das Grundproblem die Wirtschaft ist, die Inflation, „das Geld, das dir in der Tasche schmilzt“. Man dürfe nicht vergessen, dass auch die Identität eine Dimension der wirtschaftlichen und politischen Macht hat, die sie an Unterordnung bindet. In Bolivien eroberte beispielsweise die indigene Identität Anerkennung zunächst durch die Übernahme der politischen Macht und dann schrittweise wirtschaftlicher Macht innerhalb der Gesellschaft.
Schlüsselfrage Informalität
Das grundlegende soziale Verhältnis der modernen Welt ist Geld, entfremdet, aber immer noch fundamental, das, wenn es dir wegschmilzt, auch deinen Glauben und deine Treue auflöst. Das ist das Problem, das die Linke zuerst lösen muss. Dann komme der Rest, befindet García Linera. Wir befinden uns in einer historischen Zeit, wo der p rogresismo auftaucht und die extreme Rechte. Die klassische, neoliberale, universalistische Rechte verfällt, und zwar wegen der Wirtschaft. Aber die Gesellschaft, deren wirtschaftliche Probleme die alte Linke der 50er und 60er Jahre und der p rogresismo der ersten Welle (im neuen Jahrtausend) anging, hat sich verändert. Die Linke hat sich immer um die formale, entlohnte, arbeitende Klasse gekümmert. Heute ist die informelle arbeitende Klasse für den p rogresismo eine große Unbekannte. Die Welt der Informalität, die man auch unter dem Begriff „la economía popular“ versteht, ist für die Linke ein schwarzes Loch. Dafür hat sie keine produktiven Vorschläge. In Lateinamerika umfasst dieser Sektor aber bis zu 60 Prozent der Bevölkerung. Und es handelt sich nicht um eine vorübergehende Erscheinung, die bald in der formellen Wirtschaft aufgehen würde. Nein, die gesellschaftliche Zukunft wird eine mit Informalität sein, mit diesen kleinen Arbeitern, diesen kleinen Bauern, diesen kleinen Unternehmern, verbunden durch familiäre Bindungen und kuriose lokale und regionale Wurzeln, wo die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit nicht so klar sind wie im formellen Unternehmen. Diese Welt wird noch in den nächsten 50 Jahren existieren und sie schließt in Lateinamerika die Mehrheit der Bevölkerung ein. „Was sagst Du diesen Menschen? In welcher Weise kümmerst du dich um ihr Leben, ihr Einkommen, ihre Lebensbedingungen, ihren Konsum? Das sind die Schlüsselthemen für die Progressiven und die zeitgenössische Linke in Lateinamerika. Was bedeutet das? Mit welchen Werkzeugen macht man das?“, fragt der Politiker und Soziologe. Natürlich mit Enteignungen, Nationalisierungen, mit Umverteilung des Reichtums, Erweiterung der Rechte. Das sind die Werkzeuge, aber das Ziel muss die Verbesserung der Lebensbedingungen dieser 80 Prozent der Bevölkerung sein, gewerkschaftlich organisiert oder nicht, formell oder informell, die „lo popular“ in Lateinamerika darstellen, meint García Linera. Und das außerdem mit einer größeren Beteiligung an den Entscheidungen. Die Leute wollen gehört werden, wollen teilnehmen. Das vierte Thema ist die Umwelt, Umweltgerechtigkeit mit sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit, nie getrennt und nie vorweg.
Kolumbien als Vorreiter
Zur Frage nach dem Kontext und der Rolle des Gastlandes, Kolumbien, sagt García Linera: „Wenn man sich die Vorgeschichte Kolumbiens ansieht, wo wenigstens zwei Generationen von Aktivisten und Kämpfern für soziale Gerechtigkeit von Ermordung bedroht waren und ins Exil gehen mussten, wo Formen legaler kollektiver Aktionen vom Paramilitarismus in die Enge getrieben wurden und wo die USA versuchten, nicht nur aus dem Staat eine Militärbasis zu machen, sondern das Land auch kulturell zu vereinnahmen, ist es nur heroisch zu nennen, dass ein Kandidat der Linken hier an die Regierung gewählt worden ist. Und klar, wenn man das machtvolle Sediment des ‚tiefen Kolumbien‘ (colombia profunda) erfühlt, das in den Gemeinschaften und den Stadtteilen keimt, versteht man die soziale Explosion von 2021 und das „Warum“ dieses Wahlsiegs.“ Dass ihm kollektive soziale Mobilisierungen vorausgingen, habe einen gesellschaftlichen Raum für Reformen geschaffen. Daher sei die Regierung von Präsident Gustavo Petro heute die radikalste dieser zweiten progressistischen Welle auf dem Halbkontinent.
Zwei Aktionen machen die Regierung von Gustavo Petro zur Vorhut: Eine Steuerreform mit progressivem Charakter, womit jene, die mehr haben auch höhere Steuern bezahlen. In der Mehrzahl der lateinamerikanischen Staaten ist die wichtigste Steuer die Mehrwertsteuer, die eine höhere Last für die darstellt, die am wenigsten haben. An zweiter Stelle steht die Energiewende. Kein Land auf der Welt, schon gar nicht die, die sie am meisten kontaminieren – die USA, Europa, China – hat über Nacht die fossilen Brennstoffe aufgegeben. Man hat sich vielmehr Jahrzehnte zum Übergang vorgenommen und will immer noch einige Jahre lang mit einer Rekordproduktion dieser Brennstoffe leben. Kolumbien gehört zusammen mit Dänemark, Spanien und Irland zu den einzigen Ländern auf der Welt, die neue Exploration von Erdöl verbieten. Im Fall Kolumbiens ist es besonders relevant, weil Erdölexporte mehr als die Hälfte des Exportvolumens ausmachen, was diese Entscheidung zu einer sehr kühnen und weltweit sehr fortschrittlichen macht. „Es handelt sich um Reformen, die dem Leben verpflichtet sind und die den Weg ausleuchten, den andere Progressive über kurz oder lang auch gehen müssen.“ Man dürfe jedoch die kontinuierliche Verbesserung der Einkommen der kolumbianischen Unterschichten nicht aus dem Blick verlieren, weil jede Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit nichts als liberale Umwelttümelei sei. Das verlange eine millimetergenaue Abstimmung zwischen dem, was die Regierung in den nächsten Jahren an Einkommen verlieren wird, und der Erschließung neuer Einkommen, sei es durch andere Exporte, höhere Steuern für die Reichen und spürbaren Verbesserungen der Lebensbedingungen für die Mehrheit des Volkes.
Was die Rolle Lateinamerikas und der Karibik in der Welt betrifft, meint García Linera: Am Beginn des 21. Jahrhunderts habe Lateinamerika den ersten Gongschlag für die Erschöpfung des neoliberalen Zyklus gegeben. Hier lag der Beginn der Suche nach einer hybriden Mischung aus Protektionismus und Freihandel. „Heute ist die Welt im Wandel hin zu einem Regime der Akkumulation und der Legitimation, das den neoliberalen Globalismus ablöst – trotz der melancholischen Rückfälle in einen Paleo-Neoliberalismus wie in Brasilien unter Bolsonaro und in Argentinien unter Milei.“ Trotzdem sei der Halbkontinent heute etwas zu erschöpft. Es scheint, als müsse der postneoliberale Übergang erst im globalen Maßstab voranschreiten, damit Lateinamerika seine Kräfte erneuert, um den ursprünglichen Antrieb wieder aufzunehmen. Die Möglichkeit postneoliberaler Strukturreformen der zweiten Generation – oder noch radikalerer – die die transformatorische Kraft auf dem Kontinent wiedererlangen, wird auf größeren Wandel in der Welt warten müssen, und natürlich auf eine Welle kollektiver Aktionen von unten, die das Feld der denkbaren und der möglichen Transformationen verändern. Soweit dies nicht geschieht, würde Lateinamerika ein Szenario von Pendelschläge zwischen kurzfristigen Siegen des Volkes und kurzfristigen Siegen der Konservativen, zwischen kurzfristigen Niederlagen des Volkes und solcher der Oligarchien sein.
Das ursprüngliche Interview führte die kolumbianische Politologin, Feministin und Aktivistin Tamara Ospina Posse. Übersetzung und Zusammenfassung: Robert Lessmann
Zahlreiche Beiträge zur politischen Situation in Bolivien, dem Heimatland von García Linera, finden sich weiter unten in diesem Blog.

Es war Anfang des letzten Jahrzehnts in der Wiener UNO City. Juri Fedotow, ehemaliger Vizeaußenminister Russlands und diplomatisches Schwergewicht, war unlängst Chef des Drogenkontrollprogramms der Vereinten Nationen (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) geworden, ein Posten, den er von 2010 bis 2020 innehatte. Als solcher leitete er höchstpersönlich eine Pressekonferenz, auf der eine internationale Initiative zur Drogenbekämpfung in Afghanistan vorgestellt wurde. Mit 123.000 Hektar war das Land am Hindukusch zum mit Abstand größten Produzenten geworden. Mit einem ausgewogenen Ansatz („balanced approach“) sollten unter anderem die Bauern vom Schlafmohn weg zur Produktion legaler Alternativen geleitet werden. Vielversprechend war vor allem die Beteiligung der Nachbarländer an Kontrollmaßnahmen und Fahndung, denn Afghanistan ist ein Binnenland. Der Weg auf die lukrativen Absatzmärkte führt über die Grenzen. Von den wichtigsten Anbauregionen im Süden (Provinzen Helmand und Kandahar) wurde der Export zu etwa zwei Dritteln nach Westen in den Iran und die Türkei abgewickelt, und dann über die Balkanroute nach Europa. Zu etwa einem Drittel ging die illegale Ware über Hunderte von Kilometern auf einem prekären, gleichwohl aber übersichtlichen Straßensystem (Dschungel gibt es keinen) und über eine Handvoll Grenzübergänge in die ehemaligen Sowjetrepubliken Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan nach Norden. Ehemalige Ostblockländer – allen voran Russland – waren inzwischen ebenfalls zu wichtigen Absatzmärkten vor allem für minderwertige Ware („Kompott“) geworden. Kein Vergleich also zu südamerikanischen Kokainspediteuren, die mit Flugzeugen, Hubschraubern und U-Booten operieren. Doch nicht einmal dies zu unterbinden gelang: Beschlagnahmungen in Afghanistan gingen gegen Null und Korruption spielte eine wesentliche Rolle dabei.
Fundamentales Scheitern
Zurück zur Pressekonferenz, an deren Ende niemand eine Frage stellte. Um das peinliche Schweigen zu durchbrechen, fragte ich, wer sich denn mit welchen Summen der Initiative angeschlossen habe - und vergrößerte damit die Verlegenheit. Bislang hatte die neue Strategie nämlich noch keinerlei zählbare Unterstützung verbuchen können.
Dass die westliche Sicherheitskooperation fundamental scheitern würde, hatte man im Drogenbereich lange vor der „überraschenden“ Machtübernahme durch die Taliban im Sommer 2021 sehen können. Als Juri Fedotow den Chefsessel des UNODC übernahm, war Afghanistan mit 123.000 Hektar bereits der mit Abstand wichtigste Schlafmohnproduzent. Und während die legale (Land-) Wirtschaft keinerlei Dynamik entfaltete, kletterte der Anbau weiter von einem Rekord zum nächsten, gebremst nur durch Marktsättigung und gelegentliche Missernten, etwa durch Trockenheit, wie in den Jahren nach dem Allzeithoch von 2017.
________________________________________________________________________________
Schlafmohnproduktion in Afghanistan (Hektar in ausgewählten Jahren)
1995 2000 2001 2002 2010 2017 2020 2022 2023
55.759 82.171 7.606 74.100 123.000 328.000 224.000 233.000 10.800
Quelle: UNODC: World Drug Report, Vienna, verschiedene Jahrgänge und UNODC: Afghanistan Opium survey 2023.
________________________________________________________________________________________________
Heute wirbt das UNODC abermals um Unterstützung für Afghanistans Bauern, um den drogenpolitischen Erfolg zu stabilisieren. Beides hat freilich nur geringe Aussichten auf Erfolg, denn das Emirat der Taliban ist Schlusslicht bei allen Menschenrechtsstandards, bekanntermaßen insbesondere was die Lage der Frauen betrifft, und wird von Gebern gemieden. Ihr Dekret „Prohibition of Poppy Cultivation and All Types of Narcotics“ vom 3. April 2022 umfasst nicht nur Anbau, sondern auch Konsum, Transport, Verarbeitung, Handel, Import und Export – und zwar aller Drogen. Am 8. März 2023 wurde es durch ein explizites Cannabis-Verbot noch einmal bekräftigt. Ein solches Verbot galt zwar auch schon vorher unter westlicher Aufsicht. Offenbar aber verfügten die Machthaber damals über geringe Autorität, Legitimität oder politischen Willen. Jedenfalls sind nach dem Dekret der Taliban die Anbauflächen von 233.000 Hektar (2022) auf 10.800 Hektar (2023) zurückgegangen. Umgerechnet in Opium entspricht das einem Rückgang von 6.200 Tonnen auf 333 Tonnen, in Heroin rein rechnerisch von 350-480 Tonnen auf 24-38 Tonnen (bei einer durchschnittlichen Reinheit der Exportware von 50-70 Prozent).
Für die leidgeprüften Menschen und die kollabierte Volkswirtschaft bedeutet das eine riesige Herausforderung. Schon vor der abermaligen Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 war die Hälfte der Bevölkerung auf externe Hilfe angewiesen, und die Nahrungsmittelimporte waren genauso hoch wie die Eigenproduktion. Doch für diese Importe fehlt nun das Geld. Afghanistans Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist während der Herrschaft der Taliban gesunken: Um 20,7 Prozent im Jahr 2021 und um weitere 3,6 Prozent in 2022. Fast 80 Prozent der Bevölkerung leben von der Landwirtschaft, die in den letzten Jahren auch noch von Wasserknappheit betroffen war. Man durchlebt dort gerade einen weiteren Hungerwinter. Die Vereinten Nationen schätzen, dass der Rückgang der Schlafmohnproduktion für die bäuerlichen Produzenten Einkommenseinbußen von 1.360 Mio. US Dollar (USD – 2022) auf nunmehr 110 Mio. USD (2023) bedeutet. Eine schnelle Umstellung auf Weizen wäre problemlos möglich, für die defizitäre Nahrungsmittelversorgung wichtig und lässt sich in der Tat auch vielfach beobachten, brächte aber Einkommenseinbußen von rund 1 Mrd. USD mit sich. Im Jahr 2022 machten die Einkommen aus dem Opiumanbau 29 Prozent des gesamten Agrarsektors aus. Für die krisengeschüttelte afghanische Volkswirtschaft lagen die Exporterlöse des Opiumsektors stets über denen der legalen Exporte von Gütern und Dienstleistungen. Im Jahr 2021 betrugen sie schätzungsweise zwischen 1,4-2,7 Mrd. USD, was 9-14 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts entsprach, heute liegen sie bei 190-260 Mio. USD. Ob sich diese Einbußen auf Dauer verkraften lassen? Bei einer Gesamtbevölkerung von rund 40 Millionen Menschen stellt die Abschiebung von 4,4 Millionen aus Pakistan in ihr Heimatland eine zusätzliche Herausforderung dar. Und nun will auch der Iran afghanische Flüchtlinge loswerden. Das Opiumgeschäft war Afghanistans wichtigster und sicherster Wirtschaftszweig und fungierte so auch als Kreditsicherheit. Die Vereinten Nationen berichten, dass Bauern nun eine im Rahmen der „Alternativen Entwicklung“ geplante Umstellung auf einträglichere Produkte als Weizen, wie zum Beispiel Granatapfel, Mandeln, Pistazien und Asant, mangels Liquidität nicht mehr schaffen, denn die erfordert Investitionen und Geduld.
Unklare Konsequenzen
Bei der verbleibenden Schlafmohnproduktion im Land, vor allem in der Provinz Kandahar, lässt sich ein Trend zu kleineren, versteckten Flächen beobachten. In den vergangenen Jahren wurden 40-60 Prozent der Ernte in Form von Rohopium exportiert. Über die Qualität der Weiterverarbeitung zu Heroin im Lande selbst ist wenig bekannt. Sie dürfte stark variieren. Während die Herstellung von Heroin in Afghanistan allem Anschein nach zurückgeht, deutet vieles darauf hin, dass Händler nun Lagerbestände verkaufen – und die dürften nach Ansicht des UNODC nach mehreren aufeinanderfolgenden Rekordernten beträchtlich sein. Die allermeisten Bauern verkaufen ihre Ernte aber direkt und nur wenige verfügen über solche Bestände. Die Verknappung dürfte also nicht zuletzt größeren Produzenten und Drogenhändlern zugute kommen. In der Tat waren die farmgate-Preise für ein Kilogramm getrocknetes Opium im August 2023 mit 408 USD fünfmal höher als zwei Jahre vor der Machtübernahme durch die Taliban, als die Preise aufgrund immer neuer Rekordernten relativ niedrig waren.
Um die Auswirkungen auf den internationalen Drogenmärkten abzuschätzen sei es noch zu früh, sagt das UNODC. Normalerweise braucht es ein bis zwei Jahre, bis die Opiate zu den Konsumentenmärkten gelangen. Und auf dem Weg dorthin, dürfte es reichhaltige Lagerbestände geben. Theoretisch wäre eine Angebotsverknappung, ein Preisanstieg und sinkende Reinheit der Ware denkbar. Auch eine Hinwendung der Konsumenten zu billigeren und potenteren synthetischen Ersatzdrogen wie Fentalyl wäre zu befürchten. Fentanyl ist 100 Mal potenter als Morphin und wird häufig dem Heroin auch beigemischt. Fentanyl-Überdosen sind heute die häufigste Todesursache für US-Amerikaner zwischen 18 und 45 Jahren. Europa ist davon weit entfernt, doch Probleme mit Fentanyl nehmen auch hier zu.
Schließlich könnten mittelfristig andere Anbaugebiete die Lücke füllen. Bevor afghanische Mudschaheddin-Gruppen in den 1980er Jahren Opium als probates Produkt zur Finanzierung ihres Kampfes gegen die sowjetischen Besatzer entdeckten – und der Westen dies augenzwinkernd tolerierte – hatte der Anbau von Schlafmohn dort keine Rolle gespielt. Als die Taliban 1996 zum ersten Mal in Kabul einmarschierten erzeugte Afghanistan bereits zwei Drittel des Weltopiums. Beim vormaligen Marktführer Myanmar bröckelt heute die Herrschaft der Militärdiktatur. So erfreulich das ist, ein Machtvakuum würde ideale Bedingungen für eine mögliche Rückkehr der Drogenwirtschaft zu alter Größe dort schaffen. Myanmar ist schon heute wieder Nummer eins bei der Opiumproduktion. Und in Afghanistan selbst expandiert derweil die Produktion von Metamphetamin.
Wie dem auch sei: Ein erstes Anbauverbot durch die Taliban in den Jahren 2000/2001 hatte auf den Konsumentenmärkten keine Auswirkungen. Damals hatte man vermutet, die Taliban würden diese Maßnahme setzen, um auf der Grundlage voller Lagerbestände die Preise zu stabilisieren. Ob es ernst gemeint war, konnte man nicht mehr feststellen, denn Ende 2001 waren die Taliban durch die Operation „Enduring Freedom“ vertrieben und die Regierung Hamid Karzai auf der Petersberger Konferenz installiert. Der Opiumanbau war damals tatsächlich von 82.171 auf 7.606 Hektar gefallen. Aber 2002 hatte er bereits wieder alte Größenordnungen erreicht. Schlafmohn ist eine einjährige Pflanze. Zwischen Aussaat und Ernte liegen nur einige Monate. Weshalb also sollten die Taliban den dürren Halm kappen, an dem die Volkswirtschaft noch hängt? Aus religiösen Gründen, sagen sie heute wie damals. Vielleicht ist es einfach ein Versuch, mächtige Lokalfürsten und Warlords an die Kandare zu nehmen, die vom illegalen Geschäft profitier(t)en. Eine Frist erlaubte im letzten Jahr noch den Verkauf der Ernte 2022. Wie auch immer: Die Entscheidung ist problemlos reversibel.